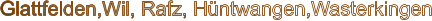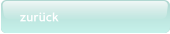In der ansonsten weit gehend von Hügeln und Tälern charakterisierten Landschaft des Zürcher
Unterlands erstaunt das Rafzerfeld mit seiner großen Ebene, die von Ratz im Osten bis nach
Hohentengen im Westen reicht und von gewaltigen Kiesgruben durchsetzt ist. Verschiedene Bohrungen,
die im Zusammenhang mit der Erforschung der Grundwasserreserven und der Kiesvorkommen
durchgeführt wurden, ergaben, dass der Felsuntergrund ein breites Tal von Rüdlingen her bis nach
Hohentengen bildet. Dieses Tal ist bis auf das heutige Niveau mit Schotterschichten aufgefüllt, deren
Mächtigkeit von Westen nach Osten auf gegen 100 Meter zunimmt. Teilweise rinden sich Schotter auch
an den Talhängen, so zum Beispiel oberhalb des Dorfs Wasterkingen. Geologische und geomorphologische
Untersuchungen haben Aufschluss über die Entstehung dieser Ebene und über die Ablagerung der
Schotter, die heute in Kiesgruben abgebaut werden, ergeben.
In die übereinander liegenden Schichten der Unteren Süßwasser-, der Oberen Meeres- und der Oberen
Süsswassermolasse tieften sich nach dem Ende der Molasseablagerungen Flüsse ein. Zu Beginn der
vorletzten Eiszeit," der Risseiszeit, floss der Rhein in der Gegend von Schaffhausen nach
Westen durch den Klettgau, die Thur durch das Rafzerfeld ebenfalls westwärts und traf bei
Waldshut auf den Rhein. Als während des ersten großen Gletschervorstoßes der Risseiszeit
eine Gletscherzunge den Zugang zum Klettgau versperrte, mussten sich die Schmelzwasser
einen anderen Weg suchen. Diesen fanden sie im Süden und gelangten so ins alte Thurtal. In
dieser Zeit wurde also der Rhein bei Schaffhausen nach Süden umgelenkt, vereinigte sich bei
Rüdlingen mit der Thur und floss -weiter durch das Rafzerfeld nach Westen. Während des
ersten vorübergehenden Rückzugs der Gletscher wurde die Rhein-Thur-Rinne wieder bis auf
etwa 400 m über Meer aufgeschottert. Davon zeugen etwa die unteren, stark verwitterten
Schichten in der Wasterkinger Kiesgrube. Das von den Flüssen vorgeformte «Rafzertal»
wurde durch
den zweiten,
größeren
Vorstoß der
risszeitlichen Gletscher
wie durch einen
überdimensionierten
Hobel tiefer
und breiter
ausgefräst.
Grosse Teile
des Rafzerfelds
waren mit Eis
überdeckt. Am
Rand und im Vorfeld der
Gletscher wurden Schotter
abgelagert, wie sie zum
Beispiel in den oberen
Schichten der Wasterkinger
Kiesgrube anzutreffen sind.
Auch die obersten Kuppen von
Gnal und Schürlibuck sowie
der steile Hang, der unterhalb
der Siedlungen Chalchofen und
Schlossbuck beginnt und sich
oberhalb der Villa
Schluchenberg hinüber zum
Zollhaus zieht und gegen das
Hohrüteli hin ausläuft, setzen sich aus
spätrisseiszeitlichen Schottern
zusammen. Nördlich an den erwähnten
Hang schließt sich ein Gebiet an, das
mit einer Moräne des
Rissgletschers bedeckt
ist. In der Warmzeit
zwischen der vorletzten
(Riss-) und der letzten
(Würm-)Eiszeit flössen
große Mengen
Schmelzwasser durch
das Rheintal (=
Rafzerfeld), räumten
dieses wieder aus und
tieften es weiter ein.
Während der
Würmeiszeit stießen
die Gletscher zum
vorläufig letzten Mal
vor, in unserer Gegend
bis Rüdlingen. Der
Maximalstand der
Würmvergletscherung
ist durch die
Wallmoränen von
Rüdlingen über Nack, Solgen, Lottstetten, Jestetren und über den Aazheimerhof bis nach Neuhausen gut
dokumentiert. Sichtbar sind heute allerdings nur noch reihenförmig angeordnete, abgeflachte Hügel, zum
Beispiel östlich der Strasse von Ratz nach Steinenkreuz. Andere Zeugen des Gletschers wie Drumlins
(längliche Hügel mit ovalem Grundriss) und Toteislöcher (Solle) finden sich zwischen Lottstetten und
Steinenkreuz. Die gewaltigen Eismassen führten, wie dies bei heutigen Gletschern zu beobachten ist,
immer große Mengen an Gerollen mit. Die GIetscherflüsse verteilten dieses Material ziemlich gleichmäßig
im Tal, das auf diese Weise langsam wieder aufgefüllt wurde. Drei Ausflusstäler der Gletscherbäche sind
heute noch zu finden: i. im Grauen Tobel, 2. von Steinenkreuz an westwärts und 3. in der Chlainertrinne,
die zum Beispiel im Schwanental sichtbar wird.