

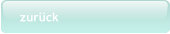

„Ossis stören nur“: Karl Döring über die Treuhand und die Missachtung ehemaliger DDR-Bürger
Erst Kombinatsdirektor des wichtigsten Stahlwerks der DDR, nach 1990 leitender Manager des Eisenhüttenkombinats Ost
(EKO), ein paar Monate lang bis zum Rauswurf, und dann Treuhand-Aufsichtsrat – die Berufsbiografie von Prof. Dr.-Ing., Dr. oec.
Karl Döring zwischen Ost und West ist einzigartig. Niemand kann authentischer vom wirtschaftlichen Umbruch nach 1990
berichten. Nun lebt der 87-Jährige mit seiner Frau Swetlana zurückgezogen in Zeuthen. Ein Gespräch über Macht und
Ohnmacht, den Umgang mit dem Osten nach 1990, die heute spürbaren politischen Folgen und die Qualitäten von Markt- und
Planwirtschaft.
Herr Professor Döring, Wikipedia nennt Sie einen „deutschen Manager“. Wie beschreiben Sie sich selbst?
Ich war in der DDR ein führender
Wirtschaftsfunktionär und hatte
in meinem angestammten Stahlunternehmen in
Eisenhüttenstadt, dessen
Generaldirektor ich zu DDR-Zeiten war, noch
bis 2010 Führungsfunktionen inne
– zuletzt in der EKO Stahl GmbH. Zu diesem
Zeitpunkt waren wir ein
Unternehmen der Gruppe Usinor, hinter der
die vereinigte französische
Stahlindustrie steckte.
Nach 2010 arbeitete ich zwei Jahre lang als
Generalbevollmächtigter dieses
Konzerns für Osteuropa und Russland und
schließlich bis 2024 als
selbständiger Unternehmensberater. Insofern
trifft die Beschreibung
deutscher Manager wohl zu. Da ich auch fast
zehn Jahre Mitglied des
Aufsichtsrates des größten russischen
Hüttenwerkes Novolipezk Steel
war, kommt noch eine russische Komponente
hinzu.
Sie haben die gesamte
Transformation des
Stahlwerkes in Eisenhüttenstadt vom
Volkseigenen Betrieb zum
Teil eines internationalen Konzerns mitgestaltet. Wie ging das vonstatten?
Die Privatisierungsprozesse nach dem Anschluss der DDR an die Bundesrepublik machen den Kern meiner Manager-Erfahrungen in der neuen
Welt aus – mit all den Möglichkeiten und Unmöglichkeiten. Es war in unserer Führungsmannschaft und im Betriebsrat, der zu Jahresbeginn 1990
gegründet wurde, unabdingbarer Wille, den Standort Eisenhüttenstadt zu erhalten. Schließlich ging es nicht nur um ein Stahlwerk, sondern um
ein komplexes Hüttenunternehmen mit Erzwirtschaft, Hochofenbetrieb, dem eigentlichen Stahlwerk und den Bereichen der
Stahlweiterverarbeitung sowie der Stahlveredlung.
Als es mit der DDR zu Ende ging, arbeiteten bei uns im EKO 12.000 Leute. Ganz Eisenhüttenstadt, die gesamte örtliche
Wirtschaft, ob Backwarenkombinat, Molkerei oder Friseursalon, lebten in irgendeiner Form vom Werk, und das gesamte dörfliche Umfeld
natürlich auch.
Sahen alle Akteure nach 1990 die Notwendigkeit, den Standort zu erhalten?
Sagen wir: viele. Es gab in der DDR-Stahlwirtschaft Standorte, von denen man annehmen konnte, dass sie in der gesamtdeutschen
Stahlwirtschaft keinen Platz mehr finden würden. Dazu gehörte die Maxhütte, die Großmutter der DDR-Metallurgie, die zwar immer wieder
modernisiert wurde, aber schon Ende des 19. Jahrhunderts entstanden war. Das erst in der DDR-Zeit erbaute Eisenhüttenstadt war modern
und neu. In Eisenhüttenstadt war allen klar: „Stirbt das Werk, dann stirbt die Stadt!“
Wie verhielt sich die Treuhandanstalt?
Das muss ich differenziert darstellen: Ich kannte den ersten Treuhandchef, Detlev Rohwedder, persönlich. Der war Chef des
Stahlunternehmens Hoesch in Dortmund. Zu dieser Zeit, als mangels entsprechender Investitionen ein wichtiger Produktionsschritt, das
Warmwalzen, im EKO nicht ausgeführt werden konnte, bestanden zwischen der DDR und der westdeutschen Stahlindustrie entsprechende
Vereinbarungen – und zwar mit den Unternehmen Salzgitter und Hoesch. Daher meine persönliche Bekanntschaft.
Rohwedder brachte eine ganz grundsätzliche Position in die Treuhand ein, nämlich: Das Aufsichtsgremium der Treuhand wird auch mit DDR-
Chefs besetzt. So landete ich in jenem Verwaltungsrat, der das laufende Geschäft zu beaufsichtigen hatte, und wurde auch zum
stellvertretenden Vorsitzenden dieses etwa 15 Mitglieder zählenden Verwaltungsrates gewählt, dem insgesamt fünf DDR-Leute angehörten. Die
Regierung Lothar de Maizières hatte uns im Juli 1990 für zwei Jahre in das wichtige Gremium berufen. Dessen Chef war zunächst Rohwedder,
der aber nach kurzer Zeit vom Aufsichtsgremium auf den Posten des Vorstandsvorsitzenden der Treuhand wechselte – also Chef des operativen
Geschäfts wurde.
Was steckte hinter diesem Personalwechsel?
Der erste Vorstandsvorsitzende, Dr. Rainer Maria Gohlke, zuvor Chef des Chaosunternehmens Bundesbahn, war sehr blauäugig, mit großen
Ankündigungen zur Privatisierung der DDR-Wirtschaft angetreten. Aber er kam nicht klar, gab nach sechs Wochen auf. Kanzler Helmut Kohl
trug daraufhin Rohwedder das operative Geschäft an: „Das müssen Sie selber machen.“
Wie erging es in dieser Zeit dem EKO?
Die Treuhand war schon unter der Modrow-Regierung gegründet worden. Die Betriebe hatten den Auftrag erhalten, sich aus volkseigenen in
privatrechtliche Strukturen umzuwandeln. In unserem Fall entstand die EKO Stahl AG – eine Aktiengesellschaft in Treuhandeigentum. Diese AG
brauchte einen Aufsichtsrat. Das Finden dieser Herren – von Damen redete man in jener Zeit nicht – zog die Treuhand an sich.
Sie besetzte die Aufsichtsräte. Rohwedder gab eine Empfehlung für den Chef unseres Aufsichtsrats und sagte mir: „Herr Döring, suchen Sie
sich Ihre übrigen Aufsichtsräte aus. Wenn Sie das vernünftig machen, genehmigen wir das.“ Der von Rohwedder empfohlene Vorsitzende Dr.
Otto Gellert, Besitzer einer privaten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aus Hamburg, kam aus dem Metier – und stellte sich schützend vor das
EKO. Und da auch er zugleich stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der Treuhand war, hatte er auch die Möglichkeit, viel
Einfluss zu nehmen. Er wollte den Standort erhalten.
Sah das auch die Treuhandanstalt so?
Nein. Der für die DDR-Stahlindustrie zuständige Vorstand in der Treuhand war Hans Krämer. Er kam aus der westdeutschen Energiewirtschaft
und schwenkte, kurz nachdem Birgit Breuel dem am 1. April 1991 vermutlich von der RAF ermordeten Rohwedder als Vorstandsvorsitzende
gefolgt war, auf die Position ein, es müsse in jedem Fall schnell privatisiert werden. Da ging der Kampf los.
Wer waren die Gegner?
Die westdeutsche Stahlindustrie, repräsentiert durch die Wirtschaftsvereinigung Stahl mit Sitz in Düsseldorf, mit der Position: „Es gibt genug
Stahl in Deutschland, die Stahlindustrie der DDR wird nicht gebraucht.“ Das gipfelte in der Ansage von Thyssenchef Heinz Kriwet: „Das EKO
ist so notwendig wie ein Kropf.“ Es gab eine übergroße Fraktion von Eisenhüttenstadt-Gegnern. Natürlich begründeten die Herren alles
„objektiv“ mit wirtschaftlichen Zusammenhängen und schwierigen Stahlmärkten. Daneben formierte sich die Pro-Eisenhüttenstadt-Fraktion mit
Dr. Gellert, einem völlig überzeugten SPD-Ministerpräsidenten Manfred Stolpe und unserer Mannschaft. Stolpe war die politische Korsettstange
für das Bemühen um die ordentliche Entwicklung des Standortes.
Gab es Kaufinteressenten für das
Stahlwerk?
Etwa 20, aber nicht jeder meinte es
ernst oder hatte die notwendigen
Potenzen dazu. Die Treuhand verlangte
dennoch, dass wir mit jedem
Interessenten ausführlich kooperieren.
Die Kaufwilligen sollten genau wissen,
wer wir sind. Viele hundert Seiten von
Dokumenten wurden zusammengestellt
und übergeben – Lagepläne, Zeichnungen.
Wir machten uns
völlig nackt, es gab keine
Informationen über das EKO, die
nicht auf dem Markt war.
Wie stellte sich das Umfeld 1990
in der DDR dar?
Wir mussten einen völligen
wirtschaftlichen Niedergang
hinnehmen, der sich besonders krass
nach der D-Mark-Einführung
entwickelte. Unsere Hauptkunden – der
Automobilbau, die Haustechnik
(Kühlschränke und Waschmaschinen), der
Elektromaschinenbau etc. – brachen
zusammen. Wir hatten kaum Abnehmer
mehr. Die Industrie der DDR
existierte vielleicht noch auf dem Papier, aber nicht mehr als wirksamer Organismus. Als Ausweg entschieden wir uns, im großen Stil in die
Sowjetunion zu verkaufen. Aus der RGW-Zeit bestanden Lieferbeziehungen, die wollten wir entscheidend ausweiten. Das war schwierig, denn
auch in der auseinanderfallenden Sowjetunion lief der wirtschaftliche Umbruch. Wir waren tätig in Russland, in der Ukraine, in Weißrussland …
Es gelang uns, Lieferverträge von jährlich über 400.000 Tonnen für
EKO-Produkte in die ehemalige UdSSR abzuschließen. Während ganze Teile der DDR-
Wirtschaft zugrunde gingen, überbrückten wir das Tal mit Lieferbeziehungen nach Osten. Wir bezogen Rohstoffe und lieferten Fertigprodukte,
die gegeneinander verrechnet wurden. Wir machten zwar keinen Gewinn, blieben aber über Wasser. Die gesamte deutsche Politik sprach vom
Zusammenbruch des Ostmarktes als Ursache für den Niedergang der DDR-Industrie – wir traten den Gegenbeweis an.
Beeindruckte das die Treuhand?
Unsere Erfolge hoben unser EKO im Treuhandportfolio hervor. Wir stabilisierten unseren Absatz und konnten sagen: „Ihr seht, es geht. Der
Standort kann entwickelt werden.“ Und wie er in der nunmehrigen Marktwirtschaft entwickelt werden könnte, zeigte das von eigenen
Mitarbeitern selbständig ausgearbeitete Zukunftskonzept, das wir überall präsentieren konnten. Dass wir verkauft, also privatisiert werden
mussten, war uns klar. Aber wir konnten der Treuhand erklären: „Unser Konzept soll die Grundlage für die Zukunft sein.“ Also: Verkaufen ja,
verramschen nein. Der Betriebsrat trug die Position voll mit.
Wie verlief dann der Verkauf des
Großobjektes EKO?
Wir als Vorstand in Eisenhüttenstadt
bestanden darauf, die von den
Kaufinteressenten vorgelegten Konzepte
mitzubewerten. Und wir waren
ziemlich gut informiert. Krupp gab auf der
Basis unseres technischen
Zukunftskonzeptes ein Kaufangebot bei
der Treuhand ab. Das war so
überzeugend, dass die westdeutsche
Stahlindustrie aufgeschreckt
reagierte, denn mit dieser Übernahme
hätte Krupp Thyssen als
Branchenführer abgelöst. Ein
Informationskrieg gegen Krupp
brach los, und die Treuhand fing an, sich
in alle Richtungen abzusichern – hier
noch ein Gutachten, da noch eins. Die
kamen nicht aus dem Kreuz, bis der
Krupp-Chef ausstieg. Da brach bei der
Treuhand eine Welt zusammen.
So kam die italienische Stahlfirma Riva
zum Zug, im Besitz des Patriarchen
Emilio Riva. Den interessierte unser
Zukunftskonzept nicht, sondern eher
die Filetstücke von Eisenhüttenstadt. Die
Treuhandanstalt, besonders Dr.
Gellert, verlangte als Voraussetzung für
ihre Unterschrift unter den
Verkaufsvertrag die Offenlegung der finanziellen Lage Rivas und seiner Potenzen. Das aber wollte Riva nicht leisten und baute darauf, dass
Frau Breuel schnell den Großbetrieb privatisieren wollte. Die Auseinandersetzungen erreichten die hohe Politik. Helmut Kohl trat mit seiner
These auf, es müssten Leuchttürme der Industrie im Osten erhalten bleiben. Riva sah seine Felle davonschwimmen und zog sich zurück.
Das klingt nach neuen Turbulenzen.
Dann ging wieder alles von vorne los. Mitte 1994 begann ein neuer Bieterwettbewerb um das EKO mit sechs Interessenten. Er führte
schließlich in eine sehr konstruktive Zusammenarbeit mit dem belgischen Stahl- und Maschinenbaukonzern Cockerill, der auch den Zuschlag für
die Übernahme der EKO Stahl GmbH erhielt. Ruhe trat jedoch nicht ein, denn 1998 wurde Cockerill von dem französischen Stahlkonzern Usinor
übernommen, und 2002 wurde diese Gruppe in den multinationalen westeuropäischen Stahlkonzern Arcelor integriert. 2007 fusionierte derselbe
mit dem auch in Europa tätigen indischen Stahlkonzern Mittal. Es war also anstrengend und emotional außerordentlich schwierig,
Eisenhüttenstadt in den sicheren Hafen zu bringen.
Wie reagierten die Treuhand-Leute auf Sie als Ostdeutschen?
Der renitente Karl Döring galt in der Treuhand als großer Störenfried, weshalb in der Zeit der schärfsten Debatten, Ende 1993 bis Mitte
1994, die Umwandlung der EKO Aktiengesellschaft in eine GmbH verfügt wurde. Die Struktur Aktiengesellschaft gab dem Eigentümer Treuhand
kaum Eingriffsmöglichkeiten ins operative Geschäft, in der GmbH ist das möglich. Parallel dazu wurde ein Manager aus dem Hause Krupp als
neuer Chef bei EKO installiert. Ich durfte als technischer Geschäftsführer bleiben. Der neue Chef war im tiefen Westen verwurzelt, aber wir
haben es trotz aller Differenzen geschafft, ein anständiges Gespann zu bilden. Auch das ging – wenn man sich mit gegenseitiger Akzeptanz
gegenübertrat.
Im verrückten Sommer 1990
übernahmen Sie als
Ostdeutscher in der Treuhand eine
Spitzenfunktion – wie
kam das?
In der Treuhand gab es die schon erwähnten
zwei handelnden Organe: den
Verwaltungsrat als Aufsichtsgremium und den
Vorstand der
Treuhandgesellschaft, der die operativen
Geschäfte führte. Rohwedder
war erst Chef des Verwaltungsrats und wollte
dort Ossis haben. Rohwedder
wollte dann auch als einen seiner beiden
Stellvertreter einen Mann aus
dem Osten und unterbreitete den Vorschlag,
mich in diese Position zu
wählen. Das war eine ehrenamtliche Tätigkeit,
aber man war natürlich nah
dran an den Geschehnissen.
Aber auf diesem Posten blieben Sie nicht
lange.Als Rohwedder an die
Spitze des Vorstandes wechselte, kam ein neuer
Vorsitzender des
Verwaltungsrats, Jens Odenwald. Bei dem war sofort klar: Die Ossis stören nur. Es dauerte nicht lange, bis er uns der Reihe nach kaltgestellt
hatte. Er organisierte die Arbeitsgruppen des Verwaltungsrates um, sodass unsere Namen nirgendwo mehr erschienen.
Gab es Gespräche?
Niemand hat mit mir geredet. Odenwald hat mich wissen lassen: „Sie haben doch mit Ihrem EKO so viel zu tun, konzentrieren Sie sich darauf.“
Davon, dass ich und meine Kollegen aus dem Osten die formale Berufung durch die DDR-Regierung für zwei Jahre hatten, war überhaupt nicht
mehr die Rede – obwohl die staatliche Einheit noch nicht offiziell vollzogen war und die de-Maizière-Regierung noch amtierte. Die
Berufungsurkunde in den Verwaltungsrat hatte Volkskammerpräsidentin Sabine Bergmann-Pohl unterschrieben.
Wie haben Sie reagiert?Ich habe Herrn Rohwedder die unglückliche Situation beschrieben und gesagt, man fühle sich überhaupt nicht mehr
willkommen. Seine klare Ansage lautete: „Herr Döring, geben Sie auf, Sie haben keine Chance, so ist jetzt das Klima.“ Sein zweiter Satz
lautete: „Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um das EKO zu retten.“ Wenn man Beispiele sucht für den Umgang mit DDR-Leuten: Hier ist der
klare Beweis, dass die westdeutsche Seite ohne jeden Respekt vorging. Einzelne wie Detlev Rohwedder bildeten die Ausnahme. Ich habe mich
nicht besonders darüber aufgeregt; mich hätte es überrascht, wenn es anders gelaufen wäre. Wir hatten ja verstanden, dass uns die andere
Seite nicht wohlgesonnen war. Mit den anderen Ost-Kollegen ist man gleichermaßen verfahren.
Also ein schleichendes Entsorgen, kein Rauswurf mit Knalleffekt.Das hätte ich noch als faire Haltung betrachtet: Wenn ein neuer Chef die
Bühne betritt, der macht Neues und beendet Altes. Der Neue hatte allerdings nicht das Recht, uns in aller Offenheit rauszuwerfen – wegen
unserer Berufungen. Aber die de-Maizière-Regierung war ja nicht mehr handlungsfrei. Eine sachlich begründete Beendigung hat jedenfalls nicht
stattgefunden. Angesichts der Lage schrieb man dann selbst eine Erklärung, dass man ausscheidet. Dieses Dokument sollte in jedem Fall
vorliegen: Alles korrekt gelaufen! So war’s.
Jetzt heißt es, die schlechte Stimmung unter den Ostdeutschen, ihre Affinität zur AfD, habe unter anderem mit dem Umgang mit der
ehemaligen DDR und ihren Bürgern nach 1990 zu tun. Dieser Umgang habe ein nachwirkendes Gefühl der Demütigung hinterlassen. Stimmen Sie
zu?
Ja, das spielt eine Rolle. Ich persönlich habe zwar schwere Zeiten durchgemacht, hatte aber keine existenziellen Probleme. Ganz anders die
Millionen Arbeitslosen. Zwar griff bei EKO und den anderen Stahlunternehmen bald die Möglichkeit der Abfindung, wie sie in der westdeutschen
Stahlindustrie üblich war. Aber wenn man einem Menschen, der immer voll berufstätig war, mit 55 Jahren sagt, hier hast du ein bisschen Geld,
geh nach Hause – für den brach eine Welt zusammen.
Und das geschah millionenfach! Die Arbeitslosigkeit lag in der Umbruchzeit in Eisenhüttenstadt bei über 20 Prozent – keinerlei Chance, neue
Arbeit zu finden. Die Betroffenen tragen die Folgen einer schwer verwundenen Lebensphase in sich – sie kamen sich aussortiert vor. Und die
Kindergeneration erlebte das alles mit! Dort liegt eine Ursache für die heutige Missstimmung. Davon bin ich überzeugt.
Haben heutige Politiker das begriffen?
Nein, die können sich das überhaupt nicht vorstellen. Weil die im Kopf haben, dass Arbeitslosigkeit zwar keine schöne Sache ist, aber eine, die
man regeln kann. In Westdeutschland hat das funktioniert, aber in der DDR war die Situation völlig anders – die Leute mussten ja nie einen
Gedanken daran verschwenden, mal arbeitslos zu sein. Und dann stehen Millionen über Nacht auf der Straße. Ihre Kollektivbindungen sind tot.
Die Orte, wo man immer hinging, gibt es nicht mehr. Der Sportverein – der Betriebssportverein – hängt auf dem absteigenden Ast. Das
gesamte persönliche Empfindungsfeld wurde in Ostdeutschland tief getroffen.
Ist das der Hauptgrund für die
miese Stimmung?
Das hat seinen Anteil, aber ich sehe
eher die aktuell falsche Politik als
Hauptgrund. Viele Sorgen treiben die
Menschen um: das schulische Umfeld
für die Kinder, das Gesundheitswesen,
die Misere im Wohnungswesen, ständig
steigende Preise. Warum gibt es nicht
mehr Bemühungen, um den Krieg in der
Ukraine zu beenden? Diese Dinge
beunruhigen viele Familien. Viele
politische Entscheidungen passen nicht
zu den Lebenssorgen der Menschen.
Manche Leute sagen, die
Fehlentwicklungen in der allgemeinen
Daseinsvorsorge seien auf das
Nichtvorhandensein langfristiger
Planung zurückzuführen, und preisen die
Vorzüge der Planwirtschaft. Andere
sehen Planwirtschaft als Tor in die
kommunistische Hölle. Und Manager
kapitalistischer Konzerne rufen nach
Planungssicherheit. Wie sehen Sie das,
als jemand, der Plan- wie
Marktwirtschaft als Akteur erlebt
hat?
Der Ruf nach Planungssicherheit ist einer nach dem Staat; wo die Marktwirtschaft selbst nicht mehr klarkommt, soll der Staat ran. Sie meinen
mit Planungssicherheit zum Beispiel das, was die Lufthansa in der Coronazeit erhielt: einen Riesenkredit vom Staat, ohne dass der ein
Mitspracherecht verlangte. Also nach dem Motto: Wenn wir das Geld haben, haben wir unsere Planungssicherheit.
Natürlich kann die Wirtschaft ohne Rahmendaten auch in der Marktwirtschaft nicht existieren. Sie braucht Leitplanken, und die werden auch
geliefert – zum Beispiel durch die Steuergesetzgebung oder durch Verbote, die etwa die Schummelei mit den Autokatalysatoren unterbanden.
Das hat allerdings wenig zu tun mit früheren Vorstellungen, den gesamten gesellschaftlichen Prozess an sich zu planen.
Wäre mehr Planung in diesem Sinne besser?
Na, da müssen wir zunächst fragen, warum es denn letztlich schiefgegangen ist mit dieser Planwirtschaft im sozialistischen Lager. Viele
Wissenschaftler meinen, dass die Ursache für das Scheitern der DDR in der Wirtschaft lag. Wenn die Planwirtschaft so gut war, wie manche
meiner alten Leidens- und Erfolgsgenossen aus der DDR denken, dann hätte es doch funktionieren sollen. So gut war sie eben doch nicht. Aus
meiner Sicht ging sie viel zu sehr in die Tiefe und engte die Spielräume der Verantwortlichen kolossal ein oder beseitigte sie gar. Es hilft
nichts zu sagen, die Planwirtschaft sei etwas Gutes, denn es wird auch heute in jedem Betrieb geplant. Es ist aber ein Unterschied, ob ich die
Gesellschaft plane oder eine Betriebseinheit. Wir haben die Gesellschaft geplant.
Hinzu kam noch die politische Willkür. Entscheidenden Einfluss hatte eine von Politbüromitglied Günter Mittag geschaffene
Wirtschaftskommission, ein Gremium, das in keiner Weise definiert oder legitimiert war. Es hatte keine Anbindung in der Volkskammer, keine
am Staatsrat, keine an der Regierung. Die Verbindungen ins Politbüro des Zentralkomitees der SED steuerte Mittag alle selber. Daraus
entstanden eine Menge subjektiver Einflüsse, die die Sachlichkeit des einigermaßen objektiven Planungsprozesses der Staatlichen Plankommission
der DDR konterkarierte.
Eine gesamtstaatliche Planung hat meiner Ansicht nach eine Chance, wenn sie auf einer lebensnahen Politik beruht; sich auf einen
überschaubaren Umfang zentraler Planungsdaten begrenzt; eine nicht zu große Anzahl von wissenschaftlich-technischen Aufgaben und Objekten
favorisiert; dem selbständigen Denken und Handeln der Verantwortlichen genügend Raum lässt; wirtschaftliche Subventionen nur in
Ausnahmefällen zulässt; soziale Subventionen auf ein erträgliches Maß beschränkt; den Preisen nicht durch zentrale Entscheidungen ihre
marktregulierende Funktion nimmt und auf einer ehrlichen Statistik beruht.
swirtschaftliche Verflechtung der Planungsdaten zu gewährleisten. Wenn dann noch eine demokratische Beteiligung der Werktätigen an dem
Planungsprozess dazukommt, wie es vielerorts in der DDR der Fall war, dann haben wir eine Alternative zur aktuellen, profitgetriebenen
Wirtschaft.
In der DDR herrschte eindeutig das Primat der Politik. Wie ist das heute? Wer setzt sich letztlich
durch? Der Wirtschaftsminister ist es offenbar nicht. Sind es die Tausenden Lobbyisten?
Die Kapitalinteressen setzen sich durch. Und das gelingt aktuell immer besser, da das aktuelle gesellschaftspolitische System doch wohl eher
ein „Chaossystem“ ist. Es gibt keine gesellschaftlich relevante Kraft mehr, die Mehrheitspositionen vertritt und deshalb Mehrheitszustimmung
erhalten würde. Unter den Parteien wäre es deshalb unabdingbar, verpflichtenden Konsens zu erreichen. Diese Fähigkeit ist jedoch völlig
abhandengekommen. Schlimm für Deutschland, denn so kommt keine gerechte und zukunftsweisende Politik zustande.








