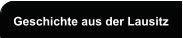Die Anfänge
Die Wolfschenke lag zwar an einem alten Handelsweg, der vor Ort Alte Heeresstraße genannt
wird und mindestens seit dem Mittelalter existierte, aber eine Schenke scheint es an dieser Stelle
nicht gegeben zu haben. Wahrscheinlich gab es im alten Dorf Wolfshain eine Schenke. In den
Görlitzer
Bekenntnissen wird
berichtet, dass 1479
Räuber in den ,,
cretschin gen
Wollhayn" geflohen
sind, dort vier
Pferde gestohlen, von
denen sie später
zwei in Spremberg
verkauften. Mit
„cretschin" ist das Wort
Kretscham gemeint,
eine vor allem in der
Oberlausitz
gebräuchliche
Bezeichnung für
einen Dorfkrug.
In seiner Chronik
der Parochie
Dubraucke, zu der
das Dorf Wolfshain
gehörte, erwähnt
Pfarrer Hermann Vetter
für die Jahre 1680
und 1790 einen
Schenker in
Wolfshain.
Dabei bezieht er
sich auf das
Rechnungsbuch der Kirche Eichwege, das für 1680 die Höhe der Abgaben des Wolfshainer
Krügers an den Pfarrer und Küster verzeichnet und das Jahr 1740 auf das Wolfshainer Urbarium.
Beide Jahreszahlen sind aber kritisch zu hinterfragen. Das Kirchenbuch nennt zwar einen Krüger in
Wolfshain, dabei wird aber nicht klar, ob es sich um eine Person mit dem Beruf Krüger oder mit
dem Namen Krüger handelt. Einmalig im Jahr 1699 erscheint ein „Girge", also George, ein
Schenkers Sohn von Wolfshain. Allerdings könnte es sich hierbei auch um einen Schreibfehler
handeln und gemeint sein könnte George Melde, Schenker in Dubebraucke. Zu den wenigen
Eintragungen, die auf einen Krüger hindeuten, gehören die Eintragungen von 1709, als „als ,,Hanß
des Krügers Von Wolffeshayn" seinen Sohn Martin taufen lässt und 1732, als „Anna die izige
Krügerin" erwähnt wird. In den anderen Dörfern der Kirchengemeinde wurde die
Berufsbezeichnung Schenker verwendet, dies könnte darauf hindeuten, dass sich alle
Eintragungen über Wolfshainer Krüger auf die Kossäten-Familie mit dem Namen Krüger beziehen
und es sehr lange keine Schenker im Ort gab. Andererseits lässt das Kirchenbuch häufig die
Familienamen weg und gibt stattdessen den Beruf an, z. B. Merlin. Schäffers Knecht; Elias, Müllers
Sohn oder Matthes Schenker und Richter in Dubraucke. Es ist sogar möglich, daß die
Berufsbezeichnung Krüger in Wolfshain zum Familienamen wurde. Eine Familie die in Wolfshain
Krüger waren, den Ausschank aufgaben, aber den Familienamen behielten.
Für das Jahr 1790 verzeichnet das Wolfshainer Urbarium alle zum Gut gehörenden Untertanen.
Neben dem Nachtwächter, Schäfer, ,,Justiciarius“, Vogt und Schweinehitren, sind dies auch
Schnitter. Harker. Groß-. Mittel-, Ochsen-, und Kuhknechte, aber auch Groll-, Mittel-, und
Kleinkutscher. Bei den Einnahmen wird auch eine „Schänk Pacht" aufgezählt, die aber mit —-——
angegeben wird. Das heißt, eine Schenke scheint nicht mehr oder noch nicht verpachtet gewesen
zu sein. Gleichzeilig ist aber das ,,neue Haus bey der Schänke" verpflichtet 8 Taler jährliche Zinsen
zu zahlen. Dies deutet daraufhin, dass die Gutsherrschaft in diesen Jahren bemüht war, die
Schenke und um sie herum eine neue Kolonie begründen.
Der Muskauer Dichter und Komponist Leopold Schefer erinnert sich an ein Treffen mit Johann
Gottlieb Fichte, dem großen Philosophen des deutschen Idealismus, der in den Jahren 1786/87
Hauslehrer der Kinder der Familie von Helbig in Wolfshain war. Über sein Treffen mit Fichte in
Wolfshain schreibt Schefer: „Einst suchten ihn Vater und Sohn in Wolfhayn auf. Man fand ihn
[Fichte] im rothen Rock, den dreieckigen Hut auf dem Kopfe, in der SCChenke, mit einem sehr
hübschen Landmädchen – das eine Braut zu sein schien – tanzend.“ Ob es sich hierbei tatsächlich
um die Wolfshainer Schenke handelt, lässt sich nicht bestimmen. Vielleicht trafen sich Schefer und
Fichte in der etwas näher gelegenen Dorfschenke in Tschernitz oder nach dem Gottesdienst in
Eichwege, wo Fichte nachweislich prädigte, vieleichtr gingen sie auch in die Schenke der
Glashütte Friedrichshain, in der man auf Glasfabrikanten traf, die zu jener Zeit höher als die
dörfliche Bevölkerung anzusehen waren.
Die Grundung einer Schenke anßerhalb des Dorfes liegt wohl im Zusammenhang mit der
Holznutzung gegen Ende des 18. Jahrhunderts und der 1766 gegründeten Glashütte
Friedrichshain. Ab 1769 werden im Eichweger Kirchenbuch unterschiedliche Pechbrenner in der
,,Wolfshaynsche[n] Heide“ genannt die sich vielleicht in der Nähe ihres Pechofens niederließen,
um bei dem tagelangen Schwelprozess vor Ort zu sein. 1794 wird auch der Hausmann George
Lehmann und seine Frau Liesa in der Wolfshaynschen Heide erwähnt - wahrscheinlich als
Bewohner des neuen Hauses hei der Schenke. Für die Pechgewinnung mussten große Mengen an
Holz verschwelt werden und der Wald wurde wie bei der Köhlerei intensiv genutzt. Das
gewonnene Pech wurde vor allem als Schmiermittel z.B. für Wagenräder und beim Bau der alten
Schrotholshäuser verwendet. Sicherlich fand es auch Einsatz in der 1766 gegründeten Glashütte
Friedrichshain, die mit ihrem hohen Holzbedarf den Holzeinschlag zusätzlich steigerte und
Freiflächen im Wald verursachte - freie Plätze für neue Siedlungen. .:
Der zunehmende Warenverkehr, auch durch die Glashütte, scheint die Gründung einer Schenke
an diesem Weg zumindest begünstigt zu haben. 1839 heißt es: ,,Übrigens befindet sich noch bei
Wolfshain eine große Glasfabrik, welche dazu beiträgt, daß Brennerei und Brauerei im besten Flore
sind.“